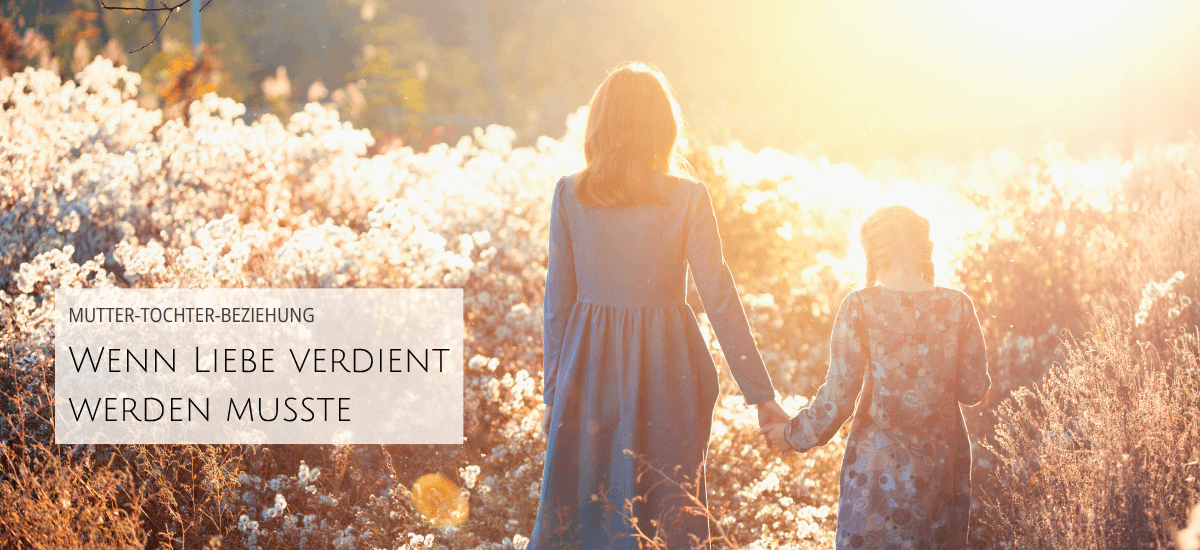
Mutter-Tochter-Beziehung
Wenn Liebe verdient werden musste
Ich habe immer wieder Gespräche mit Töchtern, deren Sehnsucht nach einer bedingungslosen mütterlichen Liebe unerfüllt ist und bleibt – “egal, was sie tun”. Dabei hat die Lady Mary Sharma in ihrer Mutterrolle in der Serie Bridgertone doch so treffend gesagt:
“Die Liebe einer Mutter muss man sich doch nicht verdienen, Kind.
Du kamst in mein Leben als eine Tochter und ich sah in Dir nie etwas anderes.”
Eine Aussage, die die Hierarchie und Verantwortlichkeiten in der Mutter-Tochter-Beziehung ganz klar und die Mutterliebe als etwas ganz Selbstverständliches herausstellt. Doch in manchen Mutter-Tochter-Beziehungen wird Zuneigung und Liebe nicht bedingungslos gegeben, sondern an Erwartungen geknüpft. Liebe erscheint dann nicht als etwas Selbstverständliches, sondern als etwas, das verdient werden muss: Durch überdurchschnittliche Leistung bis hin zur Aufopferung für Familie und Beruf oder durch übermäßige Anpassung und rigiden Gehorsam – gipfelnd in destruktivem Perfektionismus. Dieses Muster kann das Selbstbild oft bis ins hohe Erwachsenenalter prägen und sich auch in anderen Beziehungen wie beispielsweise in Freund- oder Partnerschaften zeigen.
Dadurch verinnerlichen Töchter früh im Leben Glaubenssätze, die als ständige Antreiber zu noch mehr Leistung, Anpassung und Gehorsam wirken.
Die Glaubenssätze – Die inneren Antreiber
Glaubenssätze sind tief verwurzelte Annahmen und Ansichten über uns selbst, unser Umfeld und die Welt, welche unser Fühlen, Denken und Verhalten beeinflussen. Besonders negative Glaubenssätze können unsere persönliche Entwicklung und Lebensgestaltung beeinträchtigen und zu psychischen Erkrankungen beitragen.
Beispiele typischer Glaubenssätze, die wir verinnerlichen, wenn (Mutter-)Liebe an Bedingungen geknüpft ist, sind:
Die Herkunft – Emotionales Erbe der Mutter
Vor allem Mütter der früheren Generationen haben oftmals leider selbst nie erfahren, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt. So geben sie ihre eigene Sehnsucht, ihren Perfektionismus und ihr “Funktionieren” an ihre Töchter weiter. Nicht aus Bosheit, sondern aus unbewusster Wiederholung. Familiäre Traumata und unreflektierte Erziehungsmuster setzen sich so über Generationen fort. Glücklicherweise findet heutzutage wesentlich mehr (und auch öffentlich) Aufklärung dazu statt.
Hans-Joachim Maaz1 beschreibt drei Formen von Mütterlichkeitsstörungen, die zur Entstehung dieser Glaubenssätze und im Weiteren zu seelischen Belastungen und Erkrankungen beitragen können:
Der Teufelskreis – Es wird nie wirklich perfekt sein
Die Tochter bemüht sich, passt sich an, funktioniert. Doch die Liebe bleibt distanziert. Der Wunsch, endlich gesehen zu werden, treibt zu immer mehr Leistung (Anpassung, Gehor-sam etc.) an. Aus Leistung wird Erschöpfung, aus Erschöpfung wird Depression – und manchmal Wut. Nicht gegen die Mutter, sondern gegen sich selbst – die Mutter bleibt zwangsläufig idealisiert. Da die Tochter Verantwortung und Verständnis früh in ihrem Leben gelernt hat, übernimmt sie selbst in die Verant-wortung für diese Situation und wird für das Verhalten der Mutter stets eine verständnisvolle Erklärung finden.
Bekannte und gewohnte Muster geben uns Sicherheit (weil berechenbar) und so tendieren wir dazu, diese aufrecht zu erhalten, auch wenn sie destruktiv sind. So auch die Tochter: Sie wird immer wieder Fehler und Versäumnisse ihrerseits gezielt „finden“ – aus Angst vor der Leere hinter einem möglichen Genug.
Die Folgen – Wenn die Liebe unerreichbar bleibt
Wenn das Selbstbild dauerhaft mit Funktion und Leistung verbunden ist, können depressive Verstimmungen, neurotische bzw. Persönlichkeitsstörungen und aggressive Impulse folgen. Das ist kein persönliches Versagen – sondern ein Ausdruck tiefer innerer Not.
Beispiele seelischer Belastungen und Erkrankungen bei einer unerfüllten Sehnsucht nach der Mutterliebe:
Die Auflösung – Heilen durch Bewusstwerdung
Veränderung beginnt mit der Erkenntnis: Liebe muss nicht verdient werden.
Wichtige Schritte sind:
Hierbei kann – je nach Belastungsgrad – bspw. eine Psychoanalyse, kognitive Verhaltens- oder Traumatherapie oder ein Coaching unterstützen.
Fazit
Liebe, die an Bedingungen geknüpft war oder ist, hat Dich als Tochter vielleicht geprägt – aber sie definiert Dich nicht. Töchter tragen Verantwortung für sich selbst, nicht für die emotionale Vergangenheit und Bedürftigkeit ihrer Mütter. Indem Du Deine Muster erkennst, Deine Glaubenssätze hinterfragst, Deine Bedürfnisse und auch den Schmerz in diesem Prozess akzeptierst, beginnt etwas Neues: Eine Beziehung zu Dir selbst und auch zu Deiner Mutter, die nicht auf Leistung, Anpassung oder Gehorsam basiert – sondern auf Klarheit und echter (Selbst-)Liebe.
- Hans-Joachim Maaz (2007): “Die Liebesfalle – Spielregeln für eine neue Beziehungskultur” (C.H. Beck Verlag) ↩︎
