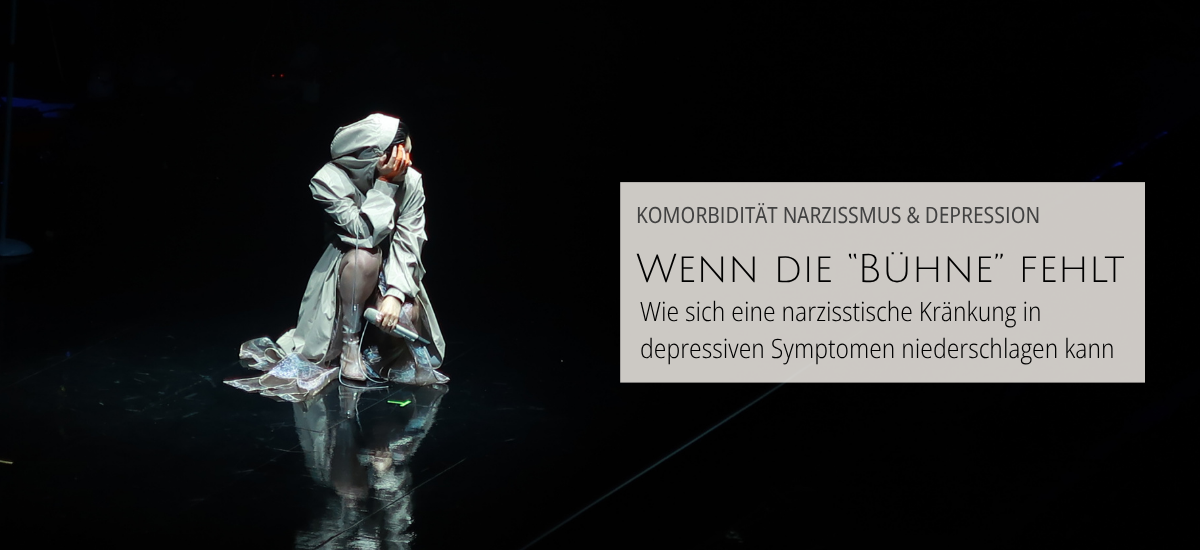
Komorbidität Narzissmus & Depression
Wenn sich eine narzisstische Kränkung in depressiven Symptomen niederschlägt
Komorbidität bedeutet, dass ein Patient neben der Grunderkrankung noch Zusatzerkrankungen hat, die gleichzeitig auftreten. Diese zusätzlichen Erkrankungen hängen kausal oft mit der Grunderkrankung zusammen. Bei einer psychischen Grunderkrankung können dabei weitere psychische oder auch körperliche Zusatzerkrankungen in Erscheinung treten.
Das gemeinsame Auftreten von narzisstischen Störungen und depressiven Symptomen ist in Psychotherapiepraxen häufig zu finden – so auch meine Erfahrung. Die Gestaltung der Behandlung bedarf dann viel Feingefühl, denn Betroffene suchen meist nicht aufgrund einer narzisstischer Störung Unterstützung durch eine Therapie, sondern aufgrund ihrer depressiven Symptome.
Depression als Zusatzerkrankung
Jeder Mensch gestaltet und nutzt Strategien (=Handlungen, Verhaltensweisen) zur bestmöglichen Bewältigung seiner indivi-duellen Herausforderungen im Alltag bzw. im Leben. So haben auch unter einem narzisstischen Defizit leidende Betroffene Strategien bzw. Verhaltensweisen in ihrem Leben etabliert, um ihren “chronischen” Selbstwertmangel zu kompensieren. Da ihre Strategien hauptsächlich auf dem Einbezug ihrer Mitmenschen basieren, ist der kompensatorische Erfolg entsprechend abhängig von diesen (Anm.: Siehe hierzu meinen früheren Beitrag “Die zwei Gesichter des Narzissmus”). Wenn nun die erhoffte Resonanz der Mitmenschen auf ihre Strategien ausbleibt, konträre Reaktionen folgen (Kritik, Spott etc.) oder gar “die Bühne fehlt” – also keine Gelegenheiten zur Inszenierung der Strategien bestehen – kann das narzisstische Defizit nicht kompensiert werden und affektive Störungen bzw. depressive Symptome können sich einstellen.
Wenn die Gelegenheit zur Kompensation wegbricht
Depressive Symptome können sich bei Betroffenen aufgrund von Veränderungen im Leben einstellen. Die alten Strategien zur Kompensation des Selbstwertmangels brechen weg, neue Strategien müss(t)en entwickelt werden – der Übergang bedeutet Stress für die Betroffenen. Beispiele:
Mitgefühl statt Blaming: Möglicherweise „triggert“ Dich das eine oder das andere Beispiel, weil es das Klischee bedient. Bitte nehme zur Kenntnis, dass ich mit meinen Texten mehr Verständnis und Mitgefühl für psychische Belastungen schaffen möchte und daher Beispiele nutze, die ich im Praxisalltag tatsächlich (häufiger) erlebt habe.
Wenn die erwartete Resonanz der Mitmenschen nicht eintrifft
Wenn die Strategien zur Kompensation des narzisstischen Defizits ins Leere laufen oder unerwartete, konträre Reaktionen des Umfeldes hervorrufen, können das Erleben von Ignoranz, Kritik oder Zurückweisung sowie der Verlust von Wahrnehmung und Anerkennung überhand nehmen. Die Betroffenen können dies dann als narzisstische Kränkung erleben, die sich schlimmstenfalls in eine narzisstische Krise ausweitet, und welche depressive Symptome wie bspw. Traurigkeit, Rückzug, innere Leere, Schuldgefühle, Ängste oder Antriebslosigkeit mit sich bringt.
In den therapeutischen Gesprächen thematisieren Betroffene gelegentlich stark das Verhalten ihres Umfelds, das sie als Ursache oder Verstärker ihrer depressiven Stimmung erleben.
Chronifizierung
Bei Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, die auf frühe negative Bindungserfahrungen zurückgehen, können sich depressive Symptome auch über Jahre hinweg entwickeln und chronifizieren. Dieser Prozess beginnt häufig bereits im jungen Erwachsenenalter.
Die Betroffenen erleben dann eine langanhaltende depressive Verstimmung mit wechselnden Phasen – zeitweise leichte Besserung, gefolgt von längeren Perioden gedrückter Stimmung. Dieses Muster entspricht dem klinischen Bild der sogenannten Dysthymia (persistierende depressive Störung).
Fazit
Depressive Verstimmungen können insbesondere bei Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen durch eine narzisstische Kränkung entstehen. Die Verletzung des Selbstwertgefühls kann dabei zu einem emotionalen Zusammenbruch führen, der sich in depressiven Symptomen äußert.
Aus meiner Sicht ist deshalb auch Psychoedukation ein zentraler Bestandteil der Therapie, damit sich Betroffene der kausalen Zusammenhänge bewusst werden und das Behandlungskonzept entsprechend ausgestaltet werden kann.
Es kann sehr entlastend sein, depressive Symptome nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als Ausdruck erlernter Bewältigungsstrategien zu verstehen, die unter veränderten Lebensbedingungen neu reflektiert und weiterentwickelt werden können.
